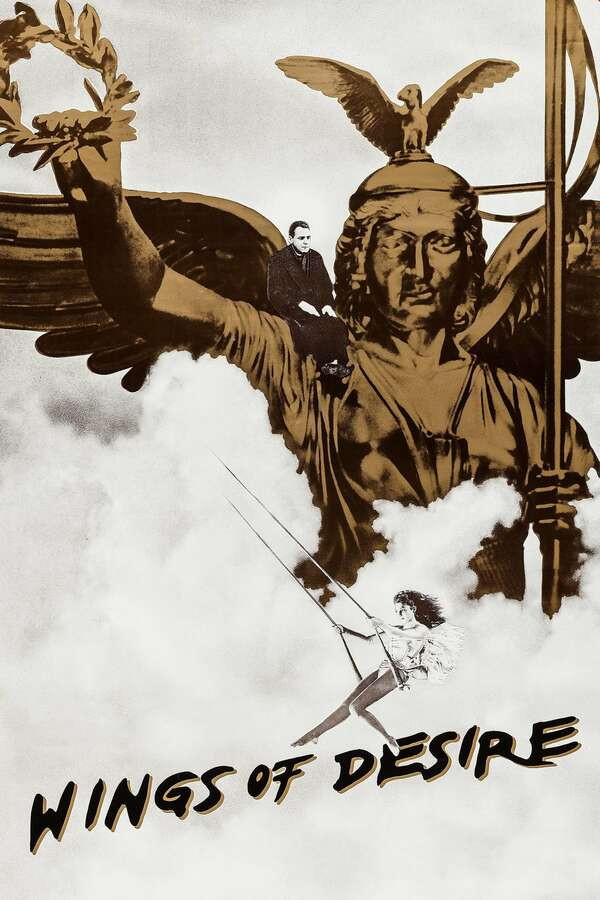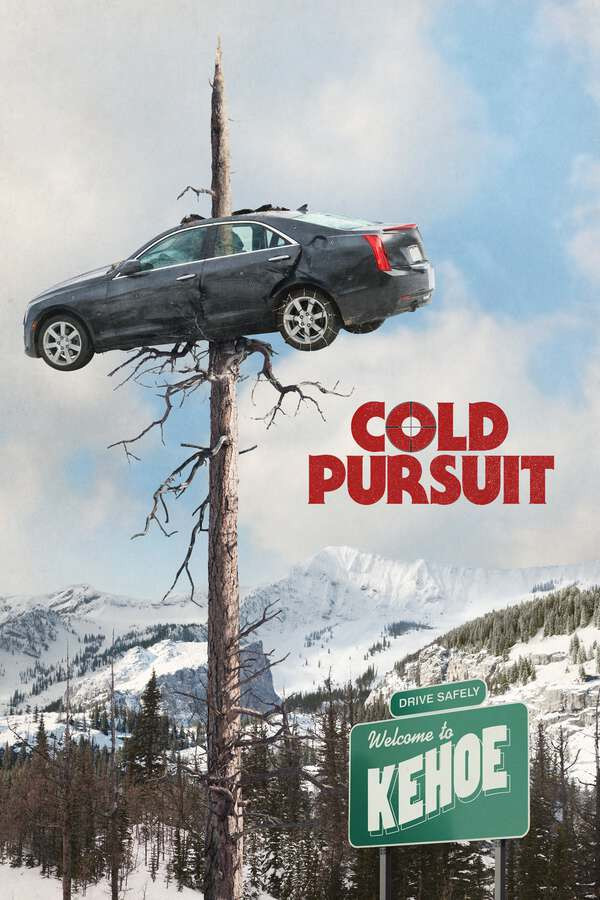Starfleet Academy und der Abschied vom Treksatlantic Accent

Früher musste ich mich erst einmal einwählen, um ins Internet zu kommen. Dabei war für mich der klassische Modemsound fast schon ein akustisches Versprechen, dass gleich irgendwo eine Nachricht auf mich wartete. Das waren oft keine verpassten ICQ-Nachrichten oder Mails im klassischen Sinne, sondern Spielzüge, die wir per Mail verschickten. Ich habe mich in meiner Schulzeit erstaunlich häufig eingewählt, weil ich wissen wollte, wie es in unseren Play by Mail Rollenspielen weiterging.
Bevor MMORPGs allgegenwärtig wurden und ganze Welten dauerhaft online existierten, erzählten wir unsere Geschichten per Mail. Ein paar Leute, jeweils mit einem Charakter, ein Spielleiter mit grober Richtungsvorgabe, und ganz viel Improvisation. Regeln gab es fast keine. Das gemeinsame Erzählen war wichtiger. Ich schrieb eine Szene, schickte sie weiter und wartete auf Reaktionen. So entstand Zug um Zug ein Abenteuer. Manchmal über Monate hinweg, manchmal nur bis unsere Geduld nachließ und wir etwas Neues anfingen.
Diese Abenteuer spielten natürlich im Star Trek Universum. Mal an der Academy, mal auf klassischen Sternenflottenschiffen, mal auf Raumstationen oder Gefangenentransportern. Es gab ernste Geschichten und parodistische. Alles existierte nur im Text, aber in unseren Köpfen war es lebendig. Rückblickend war das wahrscheinlich meine erste echte Erfahrung mit kollaborativem Schreiben.
Dabei kamen wir gar nicht darum herum, uns mit der Sprache von Star Trek zu beschäftigen. Diese merkwürdig formelle, leicht entrückte Ausdrucksweise, die viele mit der Berman-Ära verbinden. Manche nennen sie Shakespearean. Ich habe das nie ganz so gesehen. Für mich klang das eher wie eine Variante des Transatlantic Accents, nur noch stärker von Zeit und Ort gelöst. Eine Sprache, die nirgendwo wirklich verankert ist. Dem Treksatlantic Accent.
Das hat etwas Zeitloses. Dialoge altern weniger schnell, weil sie nicht an Trends hängen. Gleichzeitig entsteht aber eine Distanz. Für Außenstehende wirkt das schnell steif oder künstlich. Und ich glaube, diese Sprachform hat die typische Kammerspiel Atmosphäre vieler Trek-Serien noch verstärkt. Menschen in Räumen, die sehr kontrolliert, sehr vernünftig, sehr korrekt miteinander sprechen.
Diese Formelhaftigkeit fand sich auch im Worldbuilding wieder. Menschen standen für aufgeklärte Vernunft, Klingonen für Kriegerkultur, Romulaner für Intrigen. Spezies waren oft Charakterabkürzungen. Das passte ins Fernsehen der Achtziger und Neunziger, ließ aber wenig Raum für Widersprüche. Individualismus war möglich, aber nicht der Standard.
Uns hat das schon damals gereizt, diese Muster aufzubrechen. Also spielten wir mit Klingonen, die depressive Phasen hatten, mit Menschen mit Traumata, mit Ferengi ohne Profitinteresse und Bajoranern ohne Glauben. Gleichzeitig liebten wir natürlich die großen Picard-Reden und versuchten, so viel Shakespeare wie möglich einzubauen. Diese Mischung aus Respekt und spielerischem Bruch gehörte dazu.
Aber das alleine reichte nicht aus. Wahrscheinlich lag das an der Franchise Müdigkeit Mitte der 2000er. Unsere eigenen Geschichten waren moderner, direkter, manchmal roher. Und immer wieder tauchte die Frage auf, warum es eigentlich keine Star Trek Serie gab, die sich wirklich zeitgemäß anfühlte, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen.
Heute versucht Starfleet Academy genau diesen Spagat. Und wie so oft, wenn sich ein Franchise neu ausrichtet, ist das Fandom gespalten. Die Informationslage ist dabei fast schon ein eigenes Phänomen. Je nachdem, wonach man sucht, findet man Berichte über katastrophale oder herausragende Streamingzahlen, über angeblich gefeuerten oder weiterhin beschäftigten Kreativchefs. In Zeiten algorithmischer Wirklichkeiten kann man sich seine Wahrheit beinahe selbst kuratieren.
Ein zentraler Streitpunkt ist wieder die Sprache. Starfleet Academy verabschiedet sich hörbar vom alten Treksatlantic Tonfall. Für manche ist das ein Befreiungsschlag, für andere ein Qualitätsverlust. Kritisiert wird oft, heutige Autorinnen und Autoren könnten keine anspruchsvollen Dialoge mehr schreiben. Interessanterweise entzündet sich diese Kritik nicht selten an einzelnen Schimpfwörtern, als hinge daran die Seele des Franchise.
Dabei geht es meist um mehr. Viele wünschen sich das Star Trek, mit dem sie aufgewachsen sind. Und alles, was davon abweicht, wird schnell als Unverständnis für das Universum gelesen.
Ich sehe das differenzierter. In der dritten Folge der ersten Staffel, Vitus Reflux, funktioniert sicher nicht alles. Das Tempo ist stellenweise unrund, der Prank-Krieg mit dem War College ist eher schwach motiviert, und die Gegenseite bleibt teilweise simpel gezeichnet.
Aber ausgerechnet die Dialoge und die Charakterentwicklung gehören für mich nicht zu den Problemen. Im Gegenteil. Die Folge interessiert sich stärker dafür, wie junge Menschen miteinander sprechen, sich abtasten, aneinander reiben. Konflikte werden nicht mehr ausschließlich in moralischen Monologen gelöst, sondern in Gesprächen, die persönlicher wirken.
Ich brauche heute nicht mehr zwingend die Szene, in der alle an einem Tisch sitzen, sachlich Optionen von einer Powerpoint vorlesen lassen, abwägen und am Ende eine große Rede alles klärt. Das habe ich früher geliebt, und aus Nostalgie funktioniert das noch immer. Aber es trägt mich nicht mehr automatisch durch eine Serie.
Vitus Reflux findet seinen Reiz in der Dynamik zwischen den Figuren. Die Folge ist verspielt, oft leichtfüßig, selten cheesy. Da kann ich das Teen-Drama fast schon verzeihen. Besonders Chancellor Nahla Ake funktioniert als Figur für mich sehr gut. Ihre Art zu führen basiert weniger auf Kontrolle und mehr auf Vertrauen. Gerade ihre Szene mit Caleb zeigt das. Sie greift nicht alles vorweg, sondern lässt Raum für Entwicklung.
Darem rückt in dieser Episode stärker ins Zentrum, was mir gut gefällt. Seine Erkenntnis, dass es im Leben um mehr geht als darum, der Beste zu sein, ist dabei kein neues Motiv. Genesis bekommt ebenfalls Raum, ohne zur bloßen Streberkarikatur zu werden.
Auch die Nebenfiguren tragen zur Welt bei. Nicht jede Zeichnung ist subtil, aber vieles ist weniger schablonenhaft, als es auf den ersten Blick scheint. Selbst Gegenspieler haben Momente, in denen sie mehr sind als bloße Bullys. Und ja, ich mochte den Heist Teil, wobei ich zugeben muss, dass ich für Heist Geschichten generell empfänglich bin.
Bemerkenswert ist am Ende des Prank-Kriegs vor allem die Art seiner Auflösung. Die Kadetten entscheidet sich nicht dafür, das War-College mit den gleichen Mitteln zu schlagen oder die Eskalation weiterzutreiben. Stattdessen verlagert sich der Fokus darauf, nicht wie man einen Konflikt führt, sondern wie man ihn beendet. Der Abschluss betont Zurückhaltung, Reflexion und die Frage, welches Verhalten dem Selbstverständnis der Sternenflotte entspricht. Das passt zu der Idee einer Organisation, die sich nicht über Überlegenheit definiert, sondern über den Anspruch, Konflikte verantwortungsvoll zu handhaben.
Die Kombination aus Jett Reno und Lura Thok als Lehrende bringt zusätzlich Humor und Wärme hinein. Solche Figuren geben einer Serie Textur. Sie sorgen dafür, dass sich das Universum bewohnt anfühlt. Und wenn das jetzt noch so mit den Nebenfiguren weitergeht, spüre ich fast schon Deep Space Nine Vibes.
Vielleicht liegt hier der Kern. Starfleet Academy versucht nicht, das alte Star Trek zu kopieren. Es tastet sich vor, probiert aus, stolpert auch. Aber es wirkt lebendig. Und für ein Franchise, das seit Jahrzehnten existiert, ist Lebendigkeit vielleicht wertvoller als Perfektion.
Ich bewerte "Starfleet Academy, S01E03: Vitus Reflux" mit: